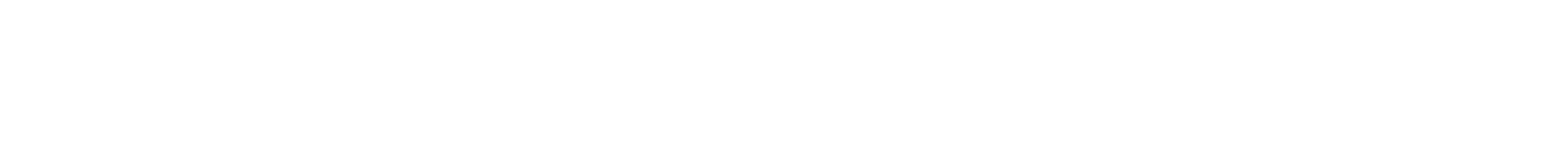Susch im Unterengadin war bisher nur als Verkehrsknoten und Autodorf bekannt. Eine polnische Milliardärin will es zum Zentrum moderner Kunst machen. Kann das funktionieren?
Veröffentlicht in: Tagesanzeiger, 28. Dezember 2018

Wird der Platz in der Kirche wohl reichen? An normalen Tagen würde Mesmer Hermann Thom so eine Frage nicht einmal in den Sinn kommen. Susch im Unterengadin hat knapp über 200 Einwohner, die meisten von ihnen gehen nicht regelmässig in den Gottesdienst. Wenn der Schnee hoch liegt oder der eiskalte Westwind durch das Tal weht, dann «kommen vier, höchstens fünf», sagt Thom, während er die Steinterrasse vor der Kirche kehrt.
Heute aber soll alles anders sein. Heute wird das Kirchlein San Jon den Ansturm der Besucher kaum fassen können. Denn heute ist ein Festtag in Susch. Die polnische Milliardärin Grazyna Kulczyk eröffnet ihr Kunstmuseum – Muzeum Susch nennt sie es, mit Z wie in der polnischen Schreibweise.
Wie ein Sechser im Lotto
Auf über 1500 Quadratmetern werden Kulczyks permanente Sammlung moderner Kunst sowie Wechselausstellungen zu sehen sein. Hinzu kommen Seminarräume, ein Veranstaltungssaal, Gästezimmer. Es ist das bei weitem grösste Museumsprojekt im Engadin der jüngsten Zeit. Zur Eröffnung geladen hat Kulczyk die Bewohner von Susch und den umliegenden Gemeinden, lokale Politiker, Galeristen, Künstlerinnen und Künstler.
In der kleinen Kirche werden polnische Musiker alte Volksmusik auf neuen Instrumenten spielen. Wer da nicht rechtzeitig kommt, wird wohl auf dem von Messmer Thom blitzblank gekehrten Vorplatz stehen müssen. Man hört dort zwar weniger, hat aber – wenn das Wetter mitspielt – einen fantastischen Blick über den Inn auf das Dorf, auf die Engadiner Berge und auf die alte Brauerei gleich hinter der Friedhofsmauer, die in den vergangenen Jahren mit viel Aufwand und Geduld von den Zürcher Architekten Chasper Schmidlin und Lukas Voellmy zum Museum umgebaut wurde.

«Immer skeptisch, immer ein wenig distanziert», so beschreibt Hermann Thom die Menschen in Susch. «Wir haben nie zu hohe Erwartungen. Und deshalb können wir nicht enttäuscht werden.» Das mag häufig zutreffen, in diesem Fall aber sicher nicht. Die Stimmung der Suscher grenzt an Euphorie. Wie ein «Sechser im Lotto» sei das Museum für das Dorf, sagt eine Bewohnerin. Das Strassendorf am Fuss des Flüela war bisher eher Stiefkind des Engadin-Tourismus. Nun werde ein «Kunstmekka» entstehen, schrieb die «Südostschweiz». Die Kunst soll Besucher und die Besucher sollen Geld ins Dorf bringen.
Zwischen Kunst und Kommerz
Für Schreinermeister Peider Müller gibt es «eine Zeit vor dem Museum. Und eine Zeit danach». Viel zu lang sei Susch in einer Art Dornröschenschlaf gelegen. Die Post, die Hotels, Läden, Beizen, die Bäckerei mussten schliessen. Von den 30 Jugendlichen, die Müller in den 80er-Jahren im Dorf kannte, sind nur zwei geblieben. Auch seinem Betrieb ging es nicht besonders gut – bis er von Kulczyk den Auftrag für die Holzarbeiten im Museum bekam. Die Polin wollte ganz bewusst mit dem lokalen Gewerbe arbeiten. «Wir waren am Untergehen, und sie hat uns den rettenden Ast zugeworfen», sagt Müller. Nun kann er neue Maschinen kaufen, Lehrlinge ausbilden.
Die enge Verbindung mit Land und Leuten sei der polnischen Milliardärin von Anfang an wichtig gewesen, bestätigt Chasper Schmidlin, der ebenfalls aus der Region stammt. Seine Urgrossmutter schrieb in Guarda den «Schellen-Ursli». «Kulczyk wollte ins einfache und authentische Unterengadin», sagt der Architekt. Auch er glaubt, dass in Susch «etwas Einmaliges entstanden ist», das viele Besucher anziehen werde.
Grazyna Kulczyk wurde 1950 in Poznan (deutsch: Posen) geboren, dem Zentrum der Wissenschaft und der Industrie in Westpolen. Die Stadt hat eine lange Tradition des Widerstands gegen polnische Herrscher oder deutsche Besatzer. Als Kulczyk sechs Jahre alt war, wurde ein Aufstand der Posener Arbeiter gegen die kommunistische Diktatur von der Armee blutig niedergeschlagen. An der Universität, wo sie öffentliches Recht studierte, lernte Grazyna ihren späteren Mann Jan kennen. Mit ihm hat sie zwei Kinder.
Jan Kulczyk stieg mit Rohstoffhandel und Privatisierungen zum reichsten Mann Polens auf. Seine Frau sammelte moderne Kunst. In den 90er-Jahren kaufte sie eine stillgelegte Brauerei nahe des Hauptbahnhofs und liess das Gelände in eine Shoppingmall mit Kunstbetrieb umbauen. Die alte Struktur der «Stary Browar» mit den roten Ziegelwänden blieben dabei weitgehend erhalten, der Umbau erhielt mehrere Auszeichnungen. Kulczyk kaufte nicht nur die Werke junger bildender Künstlerinnen und Künstler, sie förderte den modernen Tanz und gab einer bekannten polnischen Choreografin in der Brauerei eine neue Heimat. 2003 wurde das Konglomerat aus Kunst und Kommerz eröffnet. Zwei Jahre später wurde die Ehe der Kulczyks geschieden.
Palast in St. Moritz
Auch Jan Kulczyk zog es in die Schweiz. In St. Moritz liess er eine alte Villa abreissen und an ihrer Stelle den Palast «The Lonsdaleite» errichten, mit sieben Stockwerken (vier davon unterirdisch), mit Goldfolien an den Wänden und Schwimmbad mit Swarovski-Kristallen. Geniessen konnte er den Luxus nicht. Jan Kulczyk starb 2015 nach einer Operation. Sein Palast in St. Moritz steht seither zum Verkauf. Selbst ein Werbefilm eines US-Senders konnte keine Interessenten der angeblich teuersten Residenz der Schweiz anlocken. Möglicherweise liegt es am Preis von 185 Millionen Franken. Vielleicht auch an der extravaganten Einrichtung, die ganz auf den Geschmack des Erbauers ausgerichtet war. Grazyna Kulczyk beantwortet Fragen dazu nicht.
Susch ist eher das Gegenteil von St. Moritz. Autofahrern ist der Ort höchstens durch die Auffahrt zum Autoverlad Vereina bekannt und durch die Abzweigung zum Flüela-Pass. Ausser einer Klinik für Burn-out-Patienten hat das Dorf nicht viel zu bieten. Das Merkmal Gemeinde mit den wenigsten Sonnenstunden im Engadin zieht Touristen nicht gerade magnetisch an.
Dass Grazyna Kulczyk nach Susch kam, liegt an einer problematischen engen Stelle für den Autoverkehr, und die wiederum hat mit den früher ebenso häufigen wie verheerenden Bränden im Engadin zu tun. Susch brannte zum letzten Mal 1925, und weil die vormals besonders enge Durchfahrt danach verbreitert wurde, verweigert der Kanton bis heute den Bau einer Ortsumfahrung. Sehr zum Ärger der Suscher. Denn eine Strasse, die in den 1920er-Jahren als breit galt, ist heute längst nicht mehr breit genug für die SUV der Zürcher Ferienhausbesitzer. Im «Verkehrsknoten und Autodorf», wie sich Susch selbst definiert, steht der Verkehr öfter still. Auch Grazyna Kulczyk steckte im Stau.

Die Polin kam damals gerade aus Tschlin, einem Dorf auf einer Sonnenterrasse nahe der österreichischen Grenze. Dort hatte sie bei einer Tour durch das Engadin ein altes Haus entdeckt, gekauft und vom Architektenduo Schmidlin und Voellmy für ihre Wohnzwecke umbauen lassen. In diesem Haus verbringe sie die meiste Zeit, wenn sie nicht auf Reisen sei, sagt Kulczyk. Auf die Frage, ob sie nun nach Susch übersiedeln wolle, gibt sie keine konkrete Antwort.
Damals, vor ein paar Jahren, dauerte der Stau in Susch Kulczyk zu lange. Sie stellte ihr Auto ab, spazierte durch das Dorf, hinauf zu einer verfallenen Festung, die während der Bündner Wirren vom Reformer Jürg Jenatsch im Auftrag seines französischen Herrn Henry de Rohan errichtet worden war. Von der Ruine aus hat man einen prächtigen Blick auf das Dorf und die alte Brauerei der Familie Campell. Das letzte Bier wurde hier vor mehr als hundert Jahren gebraut. Danach standen die Fabrikhallen leer und interessierten nur mehr die Suscher Jugendlichen als Abenteuerspielplatz. Abseilen in die finsteren Eiskeller war streng verboten und deshalb eine beliebte Mutprobe.
Grazyna Kulczyk brauchte keine Mutprobe, um sich in die Gebäude zu verlieben. Sie hatte ja schon in Posen viel Erfolg mit dem Umbau einer Brauerei gehabt. Also begann die Polin zu kaufen: Erst das alte Brauhaus am Felshang, doch es erwies sich für ihre Visionen bald als zu klein. Also kaufte sie den Trakt auf der anderen Strassenseite dazu. Dann kamen in derselben Strasse drei alte Engadiner Bauernhäuser hinzu. Kulczyk will die Häuser als Unterkunft für sich selbst, für ihre Gäste und ihre Künstlerfreunde verwenden. Sie kündigt Aktivitäten an, die weit über den Ausstellungsbetrieb hinausgehen: Seminare, Forschungs- und Bildungsprogramme sowie ein Bistro mit Speisen der regionalen Küche.
Vom Feuer verschont
Der Messmer von San Jon, Hermann Thom, erzählt von seiner ersten Begegnung mit Kulczyk: Sie kam in seine Kirche und liess sich von ihm deren historische Bedeutung erklären: Wie hier an acht kalten Tagen zum Jahreswechsel 1537/38 in einer Disputation der Grundstein des Bündner Protestantismus gelegt wurde. Das gefiel der katholischen Kulczyk so, dass sie seither jährliche «Disputaziuns» in Susch veranstaltet. 2018 wurde über Segen und Gefahren der künstlichen Intelligenz gestritten. Im 16. Jahrhundert habe das Kloster Susch spirituelle und kommerzielle Aktivitäten vereint, sagt Kulczyk. Und genau so werde «dieses heitere und bescheidene Dorf wieder auf der Landkarte Europas erscheinen».
Die Häuser neben Kirche und Brauerei sind die ältesten des Dorfes, denn dieser Teil «an der Brücke» («sur punt») brannte niemals ab. Allerdings wusste das viele Jahrzehnte lang niemand zu schätzen. Schreinermeister Peider Müller erinnert sich an feuchte Mauern und morsches Holz im Haus seiner Grossmutter. Jedes Jahr musste er in den Dachstuhl steigen, um Ameisen zu vergiften. Jetzt gehört das Haus Kulczyk, und Müller war an der mustergültigen Restaurierung beteiligt. Beim Umbau «haben wir alte Tapeten und uralte Holzböden gefunden», erzählt Architekt Schmidlin. «Soweit es möglich war, haben wir die erhalten.» Wo neu gebaut werden musste, habe man Holz und Kalk aus der Umgebung verwendet.

Der Umbau der Brauerei dauerte drei Jahre. Er forderte den Suschern ziemlich viel ihres von Hermann Thom so gerühmten Gleichmuts ab. Vorerst brachte ihnen Kulczyks Vision vor allem Lärm, Schmutz und Verkehr. Um die Brauerei in den Felsen hinein zu erweitern, musste gesprengt werden. Schwere Lastwagen brachten Beton und führten den Aushub weg, mitten durch das Dorf.
In älteren Medienberichten über das Projekt war die Eröffnung mit Ende 2017 angekündigt. Doch «Erweiterungen und Umplanungen waren Teil des Prozesses, was auch die Bauzeit beeinflusste», sagt Architekt Chasper Schmidlin. Der Haupteingang zum Muzeum liegt nun nahe der Innbrücke. Die Besucher gelangen durch einen alten unterirdischen Gang vom Foyer in die Ausstellungsräume. Optischer Höhepunkt ist der alte Eisturm mit einer 17 Meter hohen Skulptur der polnischen Künstlerin Monika Sosnowska. In einem anderen Raum kommt Quellwasser direkt aus dem Felsen. Kulczyk habe an den richtigen Orten investiert, sie habe aber auch auf ihr Geld geschaut, «sodass es nicht absurd teuer wird», sagt Schmidlin. Die tatsächlichen Kosten wollen weder der Architekt noch die Bauherrin verraten.
Auch sonst ist die Polin mit Informationen über sich nicht gerade freizügig. Die Medienarbeit für das Muzeum Susch erledigt eine PR-Agentur in London. Diese stellt Bildmaterial zur Verfügung, der Fotograf dieser Zeitung darf weder Kulczyk noch das Innere des Muzeums fotografieren. Fragen an Kulczyk müssen schriftlich gestellt werden. Die Kontrolle über die Berichterstattung scheint der Milliardärin besonders wichtig. Dabei wird sie in Susch von jenen, die engeren Kontakt mit ihr hatten, als umgänglich und allürenfrei beschrieben. Sie gehe auf die Menschen zu, erzählt Schreinermeister Peider Müller: «Wenn sie in die Werkstatt kommt, trinkt sie ein Bier mit uns.»
Kurz nach dem Tod ihres Ex-Mannes 2015 verkaufte Grazyna Kulczyk die alte Brauerei in Posen an eine deutsche Vermögensverwaltung. Für die polnische Kulturszene war das ein Schock. «Kulczyk war so aktiv und der Kunst so verbunden», sagt die in Warschau lebende Kuratorin Agnieszka Sosnowska, «und dann hat sie plötzlich alles aufgegeben.» Sosnowska hält die Übersiedelung von Kulczyks Sammlung für einen «grossen Verlust für die Kultur in Polen, aber keinen grossen Gewinn für die Schweiz». Sie wundert sich, warum die Sammlerin ein so kleines Dorf und nicht eine grosse Stadt ausgewählt habe.
Kritik aus Polen
Kulczyks Kunstsammlung sollte eigentlich in Polen bleiben, die Brauerei Susch nur für Wechselausstellungen dienen. Doch Verhandlungen über ein eigenes Museum scheiterten erst in Posen und danach in Warschau. Angeblich wollten die Städte nicht die Kosten für den laufenden Betrieb übernehmen. In Polen habe «der Mut gefehlt, neue Wege zu beschreiten», sagte Kulczyk im Januar 2017 der «SonntagsZeitung». Heute gibt sie dazu keine Auskunft mehr. Auch die meisten Anfragen dieser Zeitung bei polnischen Künstlerinnen und Kulturinstitutionen bleiben unbeantwortet. Über dem Verhältnis zwischen Kulczyk und Polen liegt ein Schleier der Verschwiegenheit.
Kein Geheimnis aus ihrer Empörung machten Leserinnen und Leser der zweitgrössten polnischen Tageszeitung «Gazeta Wyborcza». Die Reportage der Zeitung aus Susch kommentieren sie nicht gerade freundlich. Ein Schweizer Dorf siege über polnische Städte, schreibt ein Leser: «Das sollte der polnischen Megalomanie eine Lehre sein.» Aber auch Kulczyk wird beschuldigt: Sie lasse ihr Land im Stich.
Wer wird kommen?
Wenn eine wunderbare Sammlung das Land ihrer Entstehung verlasse, sei das immer ein grosser Verlust, sagt die Leiterin des Museums für moderne Kunst in Warschau, Joanna Mytkowska. Sie hält jedoch das Muzeum Susch für einen «fantastischen Ort». Die Schweiz biete ein perfektes kulturelles Klima für eine solche Institution.
Für die Öffentlichkeit öffnet das Muzeum Susch Anfang Januar seine Tore. Die erste Ausstellung hat den Titel «Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen». Es gehe um den «Begriff des Weiblichen in seinen diversen Facetten», erklärt die Homepage. Von Beginn ihrer Sammlertätigkeit an kaufte und förderte Kulczyk vor allem junge Künstlerinnen.
Heute liegt sie damit im internationalen Trend. In Grossbritannien wird die Tate Britain in der Abteilung zeitgenössischer Kunst ein Jahr lang nur Werke von Frauen zeigen. Nun muss ein Museum in London kaum mangelnde Besucherfrequenz fürchten. Wer aber wird für Kunst nach Susch kommen? Noch dazu, wo es so viele Angebote in der Nachbarschaft gibt.
«Je mehr Kunst, desto besser»
Ein Mangel an Galerien war schon bisher nicht das Problem des Engadins. Das Unterengadin bekommt im Schloss Tarasp ein kulturelles Begegnungszentrum, im Oberengadin hat jeder Ort, der etwas auf sich hält, mindestens drei Galerien. In St. Moritz sind es sechs. Bekommen sie nun Konkurrenz in Susch? Im Gegenteil, antwortet Ladina Florineth, Inhaberin des Gästehauses Villa Flor in S-chanf: «Je mehr Kunst, desto besser.» Florineth empfand Susch bisher eher als «traurigen Ort, nicht sehr inspirierend». Kulczyks Projekt könne viel Positives bewirken.
Aroldo Zevi, Besitzer der Galerie 107 S-chanf, sieht das Muzeum als Link, der dem Tal bisher fehlte: «Es kann die kulturellen Achsen des Ober- und des Unterengadins verbinden.» Das Engadin werde zu einem einzigen Kulturraum – von Scuol bis St. Moritz.
Auf dieser Achse sind schon jetzt im Winter Tausende Osteuropäer unterwegs. An Wochenenden ist die Kolonne so dicht, dass die genervte Bevölkerung schon mal mit Strassenblockaden drohte. Das Ziel der polnischen, tschechischen oder slowakischen PW und Cars ist aber nicht das Engadin, sondern die italienische Zollfreizone Livigno. In Susch halten sie nicht, im Nachbarort Zernez nur zum Tanken. Kunst werde die Wintersportler aus dem Osten kaum interessieren, meint die Frau im Tourismusbüro: «Die wollen Partys feiern und billiges Bier trinken.»
Grazyna Kulczyk hofft ohnehin auf anderes Publikum. Ihr Muzeum solle jene anziehen, «die länger als einen Insta-Moment bleiben wollen». Sie hofft auf Kunstliebhaber, «die forschen und lernen wollen. Und die bereit sind, hier einen ganzen Tag zu verbringen.»